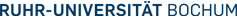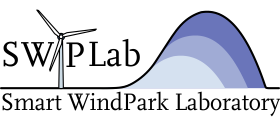Abgeschlossene Projekte seit 2011
- SWIPLab - Smart Windpark Laboratory
- KoMoM - Konzepte zur sicheren Inbetribnahme, erweiterten Nutzung und umfasenden Überwachung modularer Hochspannungs-Mehrpunktstromrichter
- SmartWind - Hochentwickelte Tools zur Optimierung von Betriebs- und Wartungsaktivitäten in Windparks
- WindOptTool - Entwicklung eines Expertensystems für die Analyse, Bewertung und Optimierung der Netzintegration von Windkraftanlagen
- interflexibEl - Intermodale und flexible Mobilitätsplanung unter Einbeziehung multifunktionaler Elektromobilität
- DGCC - Dynagrid Control Center
- MuNeSIP - Multifunktionales Netzkonditionierungssystem für sichere Stromnetze in der industriellen Produktion
- MultEMobil - Multifunktionales Elektromobil
- Secure eMobility - IT-Sicherheitstechnologien für die Elektromobilität
- Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Langstreckeneignung und -akzeptanz
- SustEner - Energie lehren für eine nachhaltige Welt
- E-DeMa - Entwicklung und Demonstration dezentral vernetzter Energiesysteme
- Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Bausteine für eine Technologie Roadmap
- BMS - Batterie Management System
- Integration von Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge im Elektrischen Verbundnetz
Smart Windpark Laboratory

Mit dem Klimaschutzabkommen von Paris 2015 hat die Bundesregierung Deutschland die globalen Herausforderungen des Klimawandels anerkannt und sich unter anderem zu einer Dekarbonisierung der Energiebereitstellung verpflichtet, die nur durch die Nutzung Erneuerbarer Energien nachhaltig erreichbar sind. Aufgrund des bisher erreichten technologischen Entwicklungsstands stellt die Windenergie eine der vielversprechendsten Technologien dar, um einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimaschutzes und der sicheren Energiebereitstellung zu leisten.
Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sourkounis wird im Rahmen dieses Forschungsvorhabens die erste Phase einer Forschungsinfrastruktur „Smart Windpark Laboratory“ (SWiPLab) konzipiert, aufgebaut und getestet, mit dem primären Ziel neue Untersuchungsmöglichkeiten für eine umsetzungsorientierte Forschung im Bereich der Windenergie zu schaffen.
Weitere Informationen
Das Vorhaben wird im Rahmen des Förderwettbewerbs „Forschungsinfrastrukturen“ durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ gefördert.
Kontakt: office@enesys.rub.de
Konzepte zur sicheren Inbetriebnahme, erweiterten Nutzung und umfassenden Überwachung modularer Hochspannungs-Mehrpunktstromrichter

KoMoM entwickelt Konzepte zur sicheren Inbetriebnahme, erweiterten Nutzung und umfassenden Überwachung modularer Hochspannungs-Mehrpunktstromrichter z.B. für ein Multiterminal-DC-Transportnetz. Dazu werden innovative Mess-, Analyse- und Regelungsverfahren mit moderner Rechnertechnik, leistungsfähigen programmierbaren Logikbausteinen und neuesten Zeitreihenmodellen verknüpft. Messungen unter Einbeziehung eines vorhandenen, derzeit einzigartigen, Multiterminal-DC-Transportnetz-Versuchsstandes dienen der Verifikation. Der Versuchsstand besteht aus vier Mehrpunktstromrichtern auf Basis von Vollbrückenmodulen in den Stromrichterzweigen und beherrscht DC-Kurzschlüsse im geregelten Betrieb. Er entstammt einem Projekt mit der Firma Amprion und emuliert die erste im Netzentwicklungsplan vorgesehene Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecke (HGÜ) „Ultranet“ (Amprion, TransnetBW).
Kurzschlussbeherrschung und -abschaltung im geregelten Betrieb erfordern hochgenaue DC-fähige Strommesstechnik auf Höchstspannungsniveau. Mess- und Regelungskonzepte hierfür werden im Projekt erarbeitet bzw. adaptiert.
Dynamische Wirk- und Blindleistungsstellung sowie Oberschwingungskompensation sind höchst relevante Netzdienstleistungen. Realisierungskonzepte, Möglichkeiten und Grenzen werden erarbeitet und erforscht. Auch die Interaktion von Stromrichtern und deren Regelung ist für stabilen Betrieb entscheidend. Das Projekt erarbeitet Beschreibungen für Stromrichter in unterschiedlichen Spannungsebenen, kombiniert diese mit einer geeigneten stromrichternahen Regelung und einer Anlagencharakteristik und leitet daraus Möglichkeiten und Grenzen des Zusammenspiels von Stromrichtern im Netz ab.
Die komplexe Stromrichtertopologie und die herausfordernde Mess- und Regelungstechnik stellen höchste Anforderungen an Inbetriebnahmekonzepte – heutige Methoden sind nicht wirtschaftlich und risikoreich. Erweiterte, spezielle Hardware-In-The-Loop (HIL)-Verfahren zur Vorabverifikation werden erarbeitet.
Die Komplexität drückt sich auch in einer Vielzahl von Messgrößen aus: An realen Anlagen fallen mehrere tausend Messdaten mehrere hundert Mal pro Sekunde an und sind zu bewerten. Dieses „Big Data“-Problem wird mit Blick auf Zustandsmonitoring und Ereignisarchivierung durch eine neuartige Ausrichtung aktueller Methoden der Zeitreihenanalyse angegangen.
Projektabschluss: 09/2020
Weitere Informationen
Ansprechpartner: M.Sc. Thomas Stoetzel
Kontakt: office@enesys.rub.de

SmartWind - Hochentwickelte Tools zur Optimierung von Betriebs- und Wartungsaktivitäten in Windparks
In Deutschland werden stetig neue und immer größere Windparks sowohl an Land, als auch auf See errichtet und auch international gewinnt die Windenergie weiter an Bedeutung. Durch den steigenden Anteil in der elektrischen Energieversorgung rücken daher neben dem Energieertrag auch die Kosten während des Betriebs und für die Wartung zunehmend in den Mittelpunkt.
Um den Betrieb und die Wartung von Windparks effizienter und zuverlässiger zu gestalten, wird in SmartWind in einem internationalen Konsortium ein KI-gestütztes „multi-kriterielles Entscheidungsunterstützungssystem“ entwickelt, das sämtliche relevanten Parameter und Messdaten innerhalb des Windparks bündelt und aufbereitet, um den aktuellen Betriebs- und Wartungszustand der einzelnen Anlagen zu rekonstruieren. Mit diesen Informationen können mithilfe moderner Algorithmen Künstlicher Intelligenz anstehende Komponentenausfälle erkannt und mit diesem Wissen die Betriebsweise und Wartungsintervalle angepasst werden. Außerdem kann die Betriebsführung der Einzelanlagen aufeinander abgestimmt werden, sodass aerodynamische Wechselwirkungen durch den Nachlauf und elektrische Wechselwirkungen durch den gemeinsamen Netzanschluss verringert werden.
Das Gesamtvorhaben wurde mit dem EUROGIA2020 – Label ausgezeichnet, welches innovative internationale Verbundvorhaben zur Reduktion des CO2-Ausstoßes unterstützt. Das Projektkonsortium unter der Leitung des KMU Enforma setzt sich zusammen aus den ICT-Unternehmen Isotrol, Enforma und Netaş, dem Windparkbetreiber Zorlu Enerji sowie Tecnalia und der RUB als Partner aus Forschung und Entwicklung.
Im deutschen Teilvorhaben des Projektes SmartWind wird die Betriebsführung des Windparks mithilfe von Verfahren zur aktiven Nachlaufregelung optimiert, um so in Summe einen höheren Energieertrag, geringere Belastungen insbesondere geschwächter Anlagenkomponenten und verringerte Netzrückwirkungen zu erzielen. Der Schlüssel zur Lösung der Optimierungsaufgabe liegt auch hier in Algorithmen künstlicher Intelligenz.
Das deutsche Teilvorhaben „Konzipierung und Realisierung KI-gestützter Windparkbetriebsführung und aktiver Nachlaufregelung“ wird von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem Förderkennzeichen „03EE2020“ gefördert.
Ansprechpartner: Philip Krajinski, M.Sc.
Projektwebseite: https://smart-wind.eu
Smartwind Faltblatt Dt
(25.8 MB)
Smartwind Faltblatt En
(25.8 MB)

WindOptTool - Entwicklung eines Expertensystems für die Analyse, Bewertung und Optimierung der Netzintegration von Windkraftanlagen

Wie können Windparks optimal geplant werden- und das trotz enormer technischer Komplexität? Mit dieser Frage beschäftigen sich das Institut EneSys der Ruhr-Universität Bochum und die Firma Avasition GmbH im Bochumer Verbundprojekt „WindOptTool“.
Als wichtiger Eckpfeiler der Energiewende gewinnt die Nutzung der Windenergie stetig an Bedeutung. Immer größere Windkraftanlagen und Windparks entstehen, um eine nachhaltigere Energieversorgung für die Zukunft zu erreichen. Hierbei ist eine gute und durchdachte Planung der Anlagen unerlässlich. Steigende Anforderungen zum Anschluss an das Netz und zahlreiche Einflüsse wie das stochastische Windaufkommen und gegenseitige Beeinflussungen der Windkraftanlagen machen dies jedoch immer schwieriger.
An dieser Stelle setzt das Projekt „WindOptTool“ an. Darin wird ein Expertensystem entwickelt, das Know-How zu allen relevanten Komponenten von Windparks bündelt. Somit können mögliche problematische Interaktionen einzelner Teilsysteme im Vorfeld entdeckt werden. Verbesserungsvorschläge zur Auslegung der verschiedenen Komponenten sorgen für Abhilfe, sodass die geplanten Anlagen insgesamt effizienter, zuverlässiger und somit rentabler werden.
An dem Kooperationsprojekt sind das Institut für Energiesystemtechnik und Leistungsmechatronik von der Ruhr-Universität Bochum und die Firma Avasition GmbH beteiligt. Am 19. Dezember 2016 fand unter Leitung des Projektkoordinators Prof. Dr. Constantinos Sourkounis der Projektauftakt an der RUB statt. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von über einer Million Euro und eine Projektlaufzeit von drei Jahren.
Das Forschungsvorhaben wurde durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ gefördert.
Ansprechpartnerin:
M.Sc. Katharina Günther
Weitere Informationen

Intermodale und flexible Mobilitätsplanung unter Einbeziehung multifunktionaler Elektromobilität

Der Wechsel des Verkehrsmittels auf dem Weg von A nach B, in Fachkreisen intermodale Mobilität genannt, und Elektromobilität sind zwei wesentliche Bausteine für die angestrebte Verkehrswende, hin zu einer ökologisch nachhaltigen Mobilität. Jedoch sind diese Mobilitätsformen für die Nutzer aktuell meist mit einem hohen Planungsaufwand, Einschränkungen und Unsicherheiten verbunden. Ein weiterer Nachteil von E-Fahrzeugen besteht für viele Nutzer in der Wirtschaftlichkeit.
Durch ein Cloudbasiertes DatenmanagementSystem (CDMS) werden im Projekt interflexibEl Angebote diverser Mobilitätsanbieter (u.a. ÖPNV, Car- & Bike-Sharing-Anbieter) sowie Echtzeitdaten von Verkehrsträgern, der Ladeinfrastruktur und ggfs. des eigenen E-Fahrzeugs vernetzt und ausgewertet. Für die Nutzer wird die intermodale Mobilitätsplanung vereinfacht, indem das CDMS auf Basis der im eigenen Kalender eingetragenen Termine und der individuellen Präferenzen und Voraussetzungen bedarfsgerecht Mobilitätslösungen errechnet und über eine Smartphone-App ausgibt. Darüber hinaus werden Ladevorgänge von E-Fahrzeugen netzdienlich und gleichzeitig nutzerorientiert gesteuert.
Gefördert vom

Ansprechpartner:
M.Sc. Daniel Breuer
Dipl.-Ing. Philipp Spichartz
Dynagrid Control Center (DGCC)
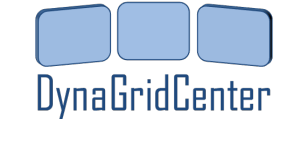
Durch die Integration von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstrecken (HGÜ) in das Europäische Verbundnetz ergeben sich neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen das herkömmliche AC-Netz und die Leitwartentechnik auf die neuen Herausforderungen von stark fluktuierenden erneuerbaren Energien angepasst werden. Durch die Umstrukturierung des Netzes von Synchron-Generator dominierten Netzen zu vielen dezentralen meist leistungselektronischen Einspeisepunkten wird die Vorhersehbarkeit erschwert und die Reaktionszeit verringert.
Durch eine Vielzahl von Messtellen (PMU) soll die Dynamische Leitwarte anhand vieler Echtzeitdaten den Netzzustand erfassen und Lösungsszenarien für kritische Netzzustände erarbeiten. Teil dieser Gegenmaßnahmen können herkömmliche Mechanismen wie Lastabwurf, etc. sein, aber auch die Regelleistung von Wirk- und Blindleistung der geplanten HGÜ Strecken. Die Mechanismen und Prinzipien sollen in einer Echtzeitsimulation eines repräsentativen Verbundnetzes mit Hardwarekopplung an ein HGÜ Modell untersucht und verifiziert werden.
Anhand von Untersuchungen am Ultranet-Versuchsstand in Bochum werden die Eigenschaften der verwendeten HGÜ Strecken untersucht und charakterisiert. Anschließend werden diese Eigenschaften in das Netzmodell integriert. Zur Optimierung der HGÜ Strecken und deren Betriebsführung wird ein Mastercontroller entwickelt. Um die HGÜ dynamisch und sicher Regeln zu können wird eine Schnittstellendefinition zwischen HGÜ und Dynamischer Leitwarte erarbeitet, welche höchste Dynamik bei beschränkter Kommunikationsgeschwindigkeit ermöglicht.
Ansprechpartner: M.Sc. Axel Rothstein
office@enesys.rub.de

Multifunktionales Netzkonditionierungssystem für sichere Stromnetze in der industriellen Produktion - MuNeSIP
Industrielle Produktionsanlagen weisen meist eine Vielzahl elektrischer Teilsysteme auf, deren Funktionalität von der Versorgungszuverlässigkeit und der Spannungsqualität des elektrischen Netzes abhängig ist, wobei insbesondere modernere Technologie durch geringere Toleranzen auffällt. Zusätzlich erhöhen die Veränderungen im Energienetz, die aus der Energiewende sowie aus der marktwirtschaftlichen Orientierung beim Netzausbau resultieren, die Häufigkeit von kritischen Netzsituationen. Dies hat negative Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen und die Produktionsqualität.
Ziel des Projektes ist es, ein dezentrales, intelligentes und modulares Netzkonditionierungssystem zu entwickeln, welches unabhängig vom auftretenden Fehlerfall zuverlässig und schnell den jeweiligen Netzzustand erkennt, wirksame Gegenmaßnahmen durchführt und somit geeignet ist die Netzqualität für Produktionsanlagen bedarfsgerecht sicherzustellen und zu erhöhen.
Das Verbundprojekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Neben EneSys als Projektkoordinator gehören die Evonik Industries AG und die Avasition GmbH dem Projektkonsortium an.
Ansprechpartner: M.Sc. Johnny Chhor

MultEMobil - Multifunktionales Elektromobil
Im Verbundprojekt „MultEMobil - Multifunktionales Elektromobil“ werden branchenübergreifende Geschäftsmodelle im Hinblick auf die multifunktionale Nutzung von Elektrofahrzeugen entwickelt. Dadurch sollen die Wirtschaftlichkeit und schließlich auch die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen gesteigert werden. Kernbereiche der multifunktionalen Nutzung sind die kooperative Nutzung durch heterogene Nutzergruppen, die dezentrale Netzstützung als dynamischer Energiespeicher und die überregionale Aufladung. Als integrierendes Element wird der Key2ME, der Schlüssel zu Mobilität und Energie, entwickelt, mit dem die beteiligten Akteure, darunter Nutzer, Mobilitäts- und Infrastrukturanbieter sowie Energieversorger, gezielt miteinander vernetzt werden können. Durch einheitliche Standards soll eine unkomplizierte Nutzung geschaffen werden, um so Hemmnisse abzubauen. Auf Basis von Simulationsuntersuchungen und Feldtestversuchen werden die erarbeiteten Geschäftsmodelle auf Alltagstauglichkeit geprüft und hinsichtlich technischer Machbarkeit sowie Wirtschaftlichkeit validiert.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Nora Becker
Dipl.-Ing. Philipp Spichartz

Secure eMobility (SecMobil)
Das Projekt SecMobil(R) wird im Rahmen der Ausschreibung „IKT für Elektromobilität II - Smart Car - Smart Grid - Smart Traffic“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführt.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung geeigneter, universell verwendbarer Sicherheits-Basistechnologien für den Einsatz in der Elektromobilität zur Erhöhung der IT-Sicherheit. Im Rahmen des Projektes werden alle Bereiche von der physikalischen Datenerfassung im sicheren eMetering, über die Infrastruktur zur sicheren Kommunikation, bis zu darauf basierenden Anwendungen als sichere Dienste, miteinander verknüpft, um in Kombination eine sehr hohe Systemsicherheit zu erzielen.
Ansprechpartner: M.Sc. Michael Schael
Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Langstreckeneignung und -akzeptanz
Ein Hauptkritikpunkt an Elektroautos, der zur Kaufzurückhaltung potentieller Kunden führt, ist deren geringe Reichweite. Daher wird im Rahmen des Kooperationsprojekts "Alltagstauglichkeit von Elektromobilität - Langstreckeneignung und -akzeptanz" die Reichweitenproblematik von Elektroautos anhand von bürgernahen Felderprobungen und Messungen untersucht.
Die Forschungen beruhen auf folgender 3-Säulen-Strategie:
1) Untersuchung und Verbesserung der Energieeffizienz im Fahrzeug
2) Erprobung und Untersuchung von Fahrzeugen mit Range-Extender
3) Erprobung und Untersuchung von schnellladefähigen Fahrzeugen
Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (ehemals Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung).
Neben EneSys als Projektleiter gehören die Adam Opel AG, die Delphi Deutschland GmbH, die GLS Gemeinschaftsbank eG, die Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Bochum Holding GmbH und die USB Bochum GmbH dem Projektkonsortium an.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Philipp Spichartz
RUB-Pressemitteilung lesen (März 2015)

SustEner - Energie lehren für eine nachhaltige Welt
Das Projekt SustEner ist Teil des EU-Bildungsprogramms für lebenslanges Lernen „Leonardo da Vinci“. Sein Ziel ist die Modernisierung beruflicher Aus- und Weiterbildung im Bereich der nachhaltigen elektrischen Energie durch Weiterentwicklung existierender oder durch Einführung neuer Trainingsmethoden im Unternehmens- und Bildungsbereich. Eine Anzahl hochqualitativer Lernmodule zur Wissensvermittlung werden erarbeitet um Methoden der Aus- und Weiterbildung sowie des Fernstudiums zu verbessern und zu modernisieren, wobei moderne Lehrmethoden wie z.B. interaktive Animationen oder Laboratorien mit Fernzugriff zur Anwendung kommen.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Frederik Einwächter

E-DeMa – Entwicklung und Demonstration dezentral vernetzter Energiesysteme hin zum E-Energy Marktplatz der Zukunft
Gemeinhin wird unterschieden zwischen denjenigen, die Energie erzeugen, und denjenigen, die sie verbrauchen, den Kunden. Bei E-DeMa existiert der Begriff des Kunden nicht; er wird abgelöst vom „Prosumer“. Darunter wird der aktive Kunde verstanden, der sowohl Energie erzeugt und in das Netz einspeist (producer), als auch konsumiert (consumer). Und genau darin liegt ein wichtiges Ziel des Projekts: Die Förderung der aktiven Einbindung und Teilnahme des Endkunden am Energiemarkt. Der im Rahmen des Projekts aufzubauende E-Energy Marktplatz 2020 basiert auf dem Verteilnetz der RWE Deutschland AG, zu dem auch die Teilnetze Mülheim und Krefeld gehören. Kern ist die Anbindung des „Prosumers“ mittels IKT-Gateways, auf deren Basis sowohl Lastenmanagement und Steuerung von Haushaltsgeräten, Smart Metering als auch die Steuerung dezentraler Einspeiser erfolgen sollen.
Der Nutzen ist vielfältig: Angezeigte Energieverbräuche oder Preissignale für den Prosumer, Online-Informationen für ein verbessertes Netzmanagement des Netzbetreibers. Mit E-DeMa entsteht eine ganzheitliche Infrastruktur zur Steuerung des Verbrauchs, bei der die Verbraucher aktiv eingebunden werden und auf deren Basis sich weitere Energiedienstleistungen etablieren können.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Frederik Einwächter

Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Bausteine für eine Technologie Roadmap: Infrastruktur – Fahrzeug – Sicherheit
Das Projekt „Technologie Roadmap“ zeichnet sich durch die Kombination aus einer detaillierten technischen Analyse des elektrischen Antriebsstrangs und der Schnellaufladung, sowie durch die Untersuchung der Alltagstauglichkeit von Elektroautos unter technischen Gesichtspunkten aus.
Ein Querschnitt der auf dem Markt verfügbaren technischen Konzepte, wie Motorart (PMSM, ASM), Schnellaufladetechnologie (50kW-DC), Antriebsbatteriespannung (96V-400V), Getriebe (1-, 3-, 5-Gang) und Rekuperationsstrategien, wird im Feld und auf dem Prüfstand analysiert und gegenübergestellt. Für die Untersuchung der Schnellaufladung wurde von der Ruhr-Universität Bochum eigens ein 50-kW-Batterieladegerät entwickelt.
Die aus dem Feldversuch gewonnenen Daten von über 70 Testpersonen liefern aufschlussreiche Informationen für die Auslegung von elektrischen Antriebssystemen hinsichtlich durchschnittlicher Reichweite, Häufigkeit und Dauer von Ladevorgängen und Antriebsleistung. Hierbei werden unterschiedliche Anwendungsfälle, wie urbane Nutzung, Pendlerverkehr, flache / hügelige / bergige Umgebung, unterschieden.
Durch die Analyse und Gegenüberstellung der technischen Lösungen in einer umfassenden Technologiematrix können zukünftige technische Entwicklungen zielgerichteter durchgeführt werden.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Philipp Spichartz

BMS - Batterie Management System
In diesem Projektrahmen wurde ein Batterie Management System (BMS) für Blei-Säure Akkumulatoren erstellt. Heutige PKW benötigen nicht nur die Fahrzeugbatterie, um den Verbrennungsmotor zu starten und die Scheinwerfer zu versorgen, vielmehr stecken gerade in Mittel- und Oberklassefahrzeugen in jeder kleinsten Nische ein Elektromotor oder Sensoren, die elektrisch versorgt werden müssen.
Diese besonders hohe Elektrifizierung von PKWs stellt besondere Anforderungen an die Fahr-zeugbatterie. Allein mit immer größer werden-den Kapazitäten kann hier nicht dem alternden Akkumulator entgegengewirkt werden. Größere Kapazitäten ermöglichen zwar eine scheinbar längere Lebensdauer, kosten dabei jedoch entsprechend mehr und verhindern in der Regel nicht das plötzliche Ausfallen des Fahrzeuges. Aufgrund der Eigenschaften einer Batterie passiert dieses gerne im Winter, in der Kälte, nach längerer Ruhezeit: genau dann, wenn man ungern auf sein Fahrzeug verzichtet.
Mit dem neu entworfenen BMS werden dem Fahrzeugnutzer die geladene Energie (Ladestand) und die verfügbare Kapazität (das Alter der Batterie) angezeigt. Zudem erlaubt das BMS die Vorhersage, ob der nächste Motorstart nach dem Abschalten möglich ist und verhindert damit ungewollte Situationen. Eine Warnung bei alternder Batterie ermöglicht den rechtzeitigen Ersatz dieser.
Das BMS agiert dabei fast völlig autark. Der Wechsel oder Einbau einer neuen Batterie wird dem BMS per Knopfdruck mitgeteilt woraufhin sich dieses während der ersten Fahrsituationen automatisch einmisst. Daraufhin gibt es Auskunft über Alter, Ladegrad und Funktion.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Philip Dost
Integration von Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge im Elektrischen Verbundnetz
Das Projekt wurde mit dem Ziel durchgeführt, Standorte für Schnellladesäulen für Elektrofahzeuge zu ermitteln. Neben den räumlichen Gegebenheiten, die für eine Schnelladestation gefunden werden sollten, ist auch die Belastungsfähigkeit des Energieversorgungsnetzes am Aufstellungsort zu berücksichtigen. Es wurden Untersuchungen bezüglich dieser Fragetellung für verschiedene Aufstellungsorte in verschiedenen Netzbezirken durchgeführt.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Alexander Broy